Hydraulikaufzug vs. Seilaufzug: Welcher Aufzugsantrieb ist geeignet?

Informiert man sich vor der Investition über Aufzüge, so steht man schnell vor der Aufgabe, sich zwischen zwei konkurrierenden Antriebssystemen zu entscheiden: dem hydraulischen Antrieb oder dem klassischen Seilantrieb. In diesem Artikel möchten wir Ihnen kurz aufzeigen, wann Sie sich für welchen Antrieb entscheiden sollten.
Der Hydraulikaufzug
Die Klasse der Hydraulikaufzüge umfasst eine Vielzahl verschiedener Bauarten: den Stempelaufzug, den Scherenaufzug oder den Aufzug auf Säulenheberbasis. Allen Bauarten gemein ist, dass die Kraft für die Hubbewegung elektrohydraulisch erzeugt wird.
Unterarten
Von den möglichen drei Varianten produzieren wir zwei Bauarten: Den Aufzug auf Basis eines Scherenhubtisches und den Aufzug auf Basis eines Säulenhebers. Diese werden jeweils um die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen erweitert.
Der Scherenaufzug
Bei einem Scherenaufzug wird die Aufzugskabine von einem hydraulischen Hubtisch angehoben. Das heißt, ein Elektromotor treibt eine Zahnradpumpe an, die Öl in die Hydraulikzylinder befördert. Die Ausfahrbewegung der Zylinder bewirkt ein Anheben der Plattform. Wenn Sie mehr über die Funktionsweise eines hydraulischen Hubtisches erfahren möchten, werden Sie im folgenden Artikel fündig: "Wie funktioniert ein hydraulischer Hubtisch?"
Der Säulenheber
Bei einem Säulenheber erfolgt die Führung der Kabine nicht über eine Hubschere, sondern über seitlich angebrachte Führungsschienen. In den seitlichen Führungen befindet sich der eigentliche Hubmechanismus. Hierbei wird das Öl von der Pumpe in den Hydraulikzylinder gepumpt. Der Hydraulikzylinder ist entweder direkt oder über eine Seiltrommel mit der Aufzugskabine verbunden.
Welche der beiden oben genannten Varianten zum Einsatz kommt, ist immer abhängig von der jeweiligen Einbausituation und den vorhandenen Geometrien. Vorteil des Säulenhebers ist seine geringe eingefahrene Höhe, sodass auch eine Installation ohne Grube möglich ist. Dafür benötigt er allerdings mehr Platz neben der Plattform.
Platzierung der Antriebseinheit
Die Platzierung der Antriebseinheit eines hydraulischen Aufzugs ist sehr flexibel. Da das Aggregat mit Hilfe von Schläuchen und Rohren mit den Hydraulikzylindern verbunden wird, ist eine Aufstellung an vielen Orten denkbar: Das Aggregat kann direkt im Hubtisch oder Schacht integriert werden oder in einem bisher nicht genutzten Raum wie unterhalb der Treppe. Selbstverständlich ist die Installation in einem separatem Antriebsraum ebenfalls möglich, wenn auch nicht zwingend erforderlich.
Wartungsaufwand
Es ist immer wieder erstaunlich, dass nur relativ wenige Komponenten für einen Hydraulikaufzug benötigt werden. Bei den verbauten Komponenten handelt es sich entweder um elektrische Sensoren mit hohen Schaltzyklen, rein mechanischen Stahlbaugruppen oder um robuste hydraulische Elemente. Neben der Sicherheitskontrolle beschränkt sich die Wartung daher zumeist auf eine Sichtkontrolle der etwaigen Hubsäulen, der Führungen und den Austausch des Hydrauliköls. Somit sind die Wartungskosten eines hydraulischen Aufzugs vergleichsweise gering.
Energieaufwand
Betrachtet man einzig und allein den Hubvorgang, so würde der Hydraulikaufzug glatt durchfallen: Der hydraulische Antrieb ist in diesem Punkt nicht allzu energieeffizient. Beim Hubvorgang eines seilbetriebenen Aufzugs wird weniger Energie aufgewandt (insbesondere, wenn ein Treibscheiben-Aufzug verbaut worden ist).
Seinen Vorteil spielt der Hydraulikaufzug jedoch im Senkvorgang aus, da das Absenken mit Hilfe des Eigengewichtes möglich ist: Ein Öffnen der entsprechenden Sicherheitsventile ist bereits ausreichend, um die Senkbewegung einzuleiten. Betrachtet man den gesamten Bewegungszyklus verbessert sich die Energiebilanz eines hydraulischen Aufzuges erheblich.
Dennoch muss festgehalten werden, dass der seilbetriebene Aufzug im Betrieb einen geringeren Energieverbrauch aufweist. Erst wenn die gesamte Lebensdauer eines Aufzugs betrachtet wird, fällt die Bewertung zugunsten des Hydraulikaufzugs aus. In diesem Fall ist der hydraulisch betriebene Aufzug mit den Nutzungskategorien 1 und 2 (bis 150 Hubzyklen) zumeist die wirtschaftlichere Lösung [s. den Artikel "Das Comeback des hydraulischen Aufzugs" vom LIFTjournal].
Hohe Förderhöhen
Wenn sehr große Hubhöhen erreicht werden müssen, wird der hydraulische Aufzug unrentabel.
Mit zunehmender Förderhöhe steigt auch die Knickgefahr für die Hydraulikzylinder, sodass größere Kolbendurchmesser erforderlich sind (s. unseren Artikel: "Wie wähle ich einen Hydraulikzylinder aus?").
Hauptanwendungsgebiet
Ein hydraulisch betriebener Aufzug wird vor allem als Güteraufzug für den Warentransport oder als Sonderaufzug mit individuellen Abmessungen eingesetzt.
Der seilbetriebene Aufzug
Der seilbetriebene Aufzug ist der Standard bei Personenaufzügen und in Hochhäusern. Unterteilt werden die seilbetriebenen Aufzüge in zwei Kategorien: den Seiltrommelaufzügen und den Treibscheiben-Aufzügen.
Unterarten
Seiltrommelaufzug
Bei Seiltrommelaufzügen wird die Seiltrommel direkt über einen Elektromotor angetrieben. Je nach Drehrichtung des Motors wird das Tragseil des Aufzugs dabei auf- oder abgewickelt und die Kabine entsprechend angehoben bzw. abgesenkt. Da bei dieser Bauweise die gesamte Energie zum Heben und Senken der Kabine vom Elektromotor bereitgestellt werden muss, findet man sie nur noch in seltenen Sonderfällen und älteren Aufzugsanlagen.
Treibscheiben-Aufzug
Weiter verbreitet sind die Treibscheiben-Aufzügen. Bei dieser Antriebsart ist die Aufzugskabine über Umlenkrollen mit einem Gegengewicht verbunden. Das Gegengewicht wird entsprechend der mittleren Belastung des Aufzugs gewählt (z. B. Kabinengewicht inkl. zweier mitfahrender Personen). Somit muss der Elektromotor nur noch die Energie für die Gewichtsdifferenz aufbringen und der Energiebedarf kann massiv gesenkt werden.
Platzierung der Antriebseinheit
Der Antrieb von seilbetriebenen Aufzügen befindet sich für gewöhnlich oberhalb des Aufzugsschachtes. Folglich ist eine entsprechend hohe Überfahrt erforderlich, um die Technik unterzubringen. Alternativ besteht oftmals die Möglichkeit, die gesamte Technik in einem speziellen Triebwerksraum unterzubringen. Der Platzbedarf für das technische Equipment ist zumeist größer als bei einem hydraulischen Aufzug, sodass zusätzlicher Raum in der Planung zu berücksichtigen ist.
Energieaufwand
Auch wenn seilbetriebene Aufzüge sowohl während des Hub- als auch während des Senkvorgangs Energie verbrauchen, ist der Energiebedarf im Betrieb geringer als bei einem Hydraulikaufzug. Teilweise findet auch eine Rückgewinnung der vorhandenen potenziellen Energie über Frequenzumrichter statt. Da die Einspeisung der so gewonnenen Energie in das öffentliche Netz allerdings mit gewissen Hürden verbunden sein kann, lohnt sich der Einsatz einer Energierückgewinnung im Regelfall nur, wenn mehrere Aufzugsanlagen gleichzeitig betrieben werden. Auf diese Weise kann im Optimalfall die rückgewonnene Energie des einen Aufzugs für den anderen Aufzug genutzt werden. Alternativ bestände auch die Möglichkeit, die Energie zu speichern und für den späteren Antrieb zu nutzen. Es gilt zu prüfen, ob sich diese Option bei den Kosten für ein Speichersystem rentiert.
Schaut man sich den gesamten Herstellungsprozess eines Aufzugs an, verfügt der Hydraulikaufzug zumeist über eine bessere Bilanz: Da der Energieverbrauch während der Herstellung wesentlich geringer ist, macht sich der geringere Energieverbrauch von seilbetriebenen Aufzügen während des Betriebs je nach Nutzungsintensität des Aufzugs erst nach mehr als 16 Jahren bemerkbar (Quelle: "Das Comeback des hydraulischen Aufzugs" vom LIFTjournal). Die Anschaffung eines Hydraulikaufzugs kann sich also lohnen, wenn es sich um einen Aufzug der Nutzungskategorie 1 oder 2 handelt (das heißt, wenn weniger als 150 Hübe/Tag durchgeführt werden).
Hohe Förderhöhen
In diesem Punkt spielt der seilbetriebene Aufzug seine volle Stärke aus. Da es keine Zylinder gibt, die auf Knickung beansprucht werden, sondern nur auf Zug belastete Seile, lassen sich große Förderhöhen wesentlich wirtschaftlicher erreichen als mit einem Hydraulikaufzug. Aus diesem Grund findet man in sehr hohen Gebäuden ausschließlich seilbetriebene Aufzüge. Das Limit für seilbetriebene Aufzüge ist erst erreicht, wenn das Tragseil so lang wird, dass es nur noch sein eigenes Gewicht tragen kann.
Hauptanwendungsgebiet
Seilbetriebene Aufzüge findet man vor allem als Personenaufzüge, bei Aufzügen mit sehr hohen Förderhöhen und/oder bei hochfrequentieren Aufzugsanlagen. Ohne diese Art der Aufzugsanlagen wären unsere jetzigen Skylines nicht vorstellbar.
Fazit
Im Folgenden eine kurze Übersicht, wann sich welcher Aufzug eignet. Selbstverständlich gilt im Einzelfall immer, dass eine individuelle Beratung auch ein anderes Ergebnis hervorbringen kann:
| Merkmal | Hydraulikaufzug | Seilbetriebener Aufzug |
|---|---|---|
| Große Förderhöhen | X | |
| Geringe Hubzyklenzahl (kleiner 150 Hübe/Tag) | X | |
| Spezielle Einbausituation | X | |
| Standardschachtmaße | X |






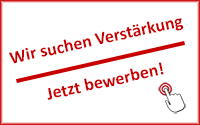
Comments (0)
No comments found!